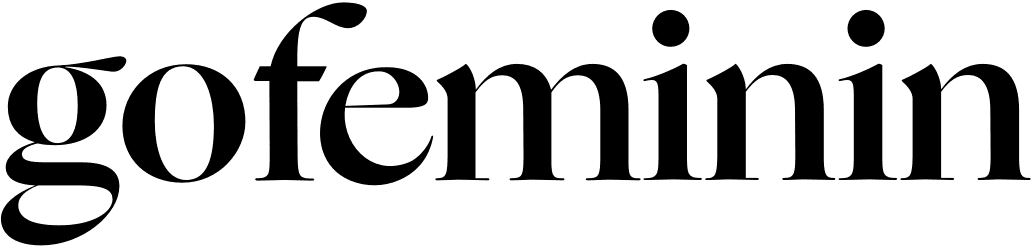„Solange Inklusion aus Freiwilligkeit heraus geschieht, sind Menschen mit Behinderung auf die Gutmütigkeit anderer angewiesen. Solange diese Abhängigkeit besteht, wird Inklusion nicht stattfinden“, sagt Laura Gehlhaar.
Sie hat Sozialpädagogik und Psychologie studiert, ist ausgebildete Coachin und arbeitet als Autorin, Beraterin und Rednerin. Laura Gehlhaar berät internationale Unternehmen und Organisationen zu Inklusion und Barrierefreiheit.
Im Interview erzählt sie, weshalb „selbst schäbige Tankstellenbistros irgendwo im Hinterland der USA“ barrierearmer sind als viele Orte hierzulande, warum es in Deutschland derzeit vielen Menschen schlecht geht und wo sie Stellschrauben für eine gleichberechtigte Gesellschaft sieht.
Laura, dir folgen bei Instagram tausende Menschen. Welche gesellschaftspolitische Entwicklung beschäftigt dich derzeit am stärksten?
„Inklusion und der Kampf für die Rechte behinderter Menschen. Das beschäftigt mich nicht nur heute, sondern seit Jahren – und zieht sich durch alle Bereiche meines Lebens. Ich habe dieses persönliche Anliegen irgendwann zu meinem Beruf gemacht. Das ist mal gut und mal schlecht.“
Inwiefern?
„Es ist gut, weil es mir ermöglicht, viel Zeit für ein Anliegen aufzuwenden, das mich selbst, aber auch viele andere Menschen betrifft. Mich jeden Tag mit Inklusion auseinanderzusetzen und laufende Entwicklungen zu reflektieren, hilft mir bei der Verarbeitung des Themas.
Schlecht daran ist die fehlende Abgrenzung zu meinem Job nach Feierabend. Meine Behinderung ist immer mit dabei – und damit auch die Diskriminierung, die ich aufgrund dessen erfahre. Das gilt es auszubalancieren. Ich musste Mechanismen finden, die mir dabei helfen, das – und das muss man so sagen – zu überleben.“
„Meine Behinderung ist immer mit dabei – und damit auch die Diskriminierung, die ich aufgrund dessen erfahre.“
Laura Gehlhaar
Was tut dir da gut?
„Freundschaften. Zeit mit Menschen zu verbringen, die mit der Thematik kaum etwas am Hut haben, für die Behinderung nicht so präsent ist in ihrem Leben. Natürlich ist die Behinderung präsent, wenn ich im Raum bin, doch wir sprechen bewusst über andere Themen.
Auch der Kontakt zu behinderten Freund*innen lädt meine Akkus auf. Im Gespräch über unsere Erfahrungen kann ich das Erlebte verarbeiten, fühle mich verstanden. Sie holen mich aus meinem Gedankenkarussell. Besonders schön ist es, wenn sich die beiden Gruppen vermischen.“
Du hast vergangenes Jahr eine Weile in den USA gelebt und gesagt, wie viel unbeschwerter du dich dort durch den Alltag bewegen konntest. Was war in den USA anders?
„Es gibt so viele Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Aber was mir aus der Perspektive einer Frau, die im Rollstuhl sitzt, auffällt, ist die Barrierefreiheit. Die USA sind da auch nicht perfekt.
Ich bin im Gegensatz zu anderen Personen nicht auf Untertitel, Gebärdendolmetscher*innen oder Blindenleitsysteme angewiesen, die ebenso Teil von Barrierefreiheit sein müssen. Aber mit Blick auf meine Mobilitätsbehinderung konnte ich mich fast uneingeschränkt bewegen.“
Warum sind die USA barrierearmer?
„In den USA gelten andere Gesetze für Menschen mit Behinderungen. Der Americans with Disabilites Act (ADA), ein Bundesgesetz, besagt, dass öffentliche Gebäude und Transportmittel zugänglich sein müssen. Die Barrierefreiheit ist gesetzlich vorgeschrieben.
Natürlich gibt es in den USA Orte, die nicht barrierefrei sind, gewisse U-Bahnstationen beispielsweise. In den USA habe ich mit dem ADA jedoch das Gesetz auf meiner Seite. Es ermöglicht mir, das Recht auf Barrierefreiheit einzuklagen. Dieses Recht fehlt in Deutschland – und das macht im Alltag einen großen Unterschied.“
Wie äußert sich das im Alltag?
„Während meines letzten USA-Aufenthalts war ich viel in Portland unterwegs. Dort konnte ich mich spontan verabreden, ohne einen Treffpunkt vorher auf seine Barrierefreiheit hin zu recherchieren. Ich musste auch nicht im Restaurant anrufen und fragen ,Komme ich mit dem Rollstuhl zur Tür rein? Kann ich die Toilette nutzen?‘
Wir waren viel mit dem Auto unterwegs und selbst schäbige Tankstellenbistros irgendwo im Hinterland hatten eine Rampe an der Tür und eine Behindertentoilette. Ich musste mir all diese Informationen nicht mehr selbst erarbeiten, sondern konnte darauf vertrauen, dass Barrierefreiheit gegeben ist.“
Gleicher Lohn ist keine Verhandlungssache
Frauen verdienen im Schnitt nach wie vor weniger als ihre männlichen Kollegen. Dass gleicher Lohn aber eben keine Verhandlungssache ist, hat das Bundesarbeitsgericht mit einem Grundsatzurteil nun bestätigt.
Was macht das mit dir?
„In dieser Zeit ist eine große Last von mir abgefallen. Mich freier durch die Welt bewegen zu können, verändert meine Wahrnehmung, auch die von mir selbst. Meine Körperhaltung verändert sich, ich sitze aufrechter und sehe mich als natürlicher Bestandteil der Gesellschaft, weil ich überall sein darf. Das macht viel mit meinem Selbstbewusstsein.
Und das Geilste ist: Ich habe überall andere behinderte Menschen gesehen. Jeden Tag begegneten mir Rollstuhl-fahrende oder humpelnde Menschen, weil sie die gleiche infrastrukturelle Barrierefreiheit erfahren wie ich.
Und weil behinderte Menschen in den USA mehr Zugang haben zu öffentlichen Räumen, ist das Bild von Menschen mit einer Behinderung in den USA viel natürlicher als in Deutschland.“
Wie äußert sich das hier, zurück in Berlin, für dich?
„Wenn ich mich in Deutschland im öffentlichen Raum bewege, bin ich eine Ausnahmeerscheinung und ziehe Blicke auf mich. Gestern erst habe ich einmal mehr eine Situation erlebt, die exemplarisch dafür ist.
Ich war in Berlin unterwegs, es war windig und ich zu dünn angezogen. Also habe ich mich eine Weile im Windschatten in die Sonne gestellt, um mich aufzuwärmen. Auf einmal kamen zwei Kinder an mir vorbei, zeigten mit dem Finger auf mich und lachten mich aus. Die Mutter und Oma der Kinder watschelten mit etwas Abstand hinterher.
Als sie die Situation bemerkten, haben sie die Kinder angebrüllt, sie sollen sofort herkommen. Gleichzeitig versuchten sie – so gut es ging – meinem Blick auszuweichen und mich zu ignorieren.“
Auch lesen: Laut Studie: Frauen behandeln Schmerzen meist selbst, statt zum Arzt zu gehen
Das klingt sehr verletzend. Was ging da in dir vor?
„Natürlich habe ich die Kinder mit meinem Blick getötet und allen Beteiligten die Pest an den Hals gewünscht, aber verletzt hat mich das Ganze nicht so sehr. Vielmehr habe ich die Situation mit Interesse beobachtet, weil sie gut zeigt, wie selten der Blick auf Behinderung in unserer Gesellschaft ist und welche komischen Reaktionen das auslöst.
Irritation, Ignoranz, Belustigung, Glotzen. Das macht viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Ich habe von Natur aus ein gutes Selbstbewusstsein und kann mich gut wehren. Umso mehr hat es mich gewundert, dass ich nicht auf diese Menschen zugerast bin und sie zurechtgewiesen habe.
Es ist okay, dass ich nicht darauf reagiert habe, aber durch solche Erlebnisse geht viel Energie verloren. Ich befinde mich andauernd in Alarmbereitschaft, das ist anstrengend. In den USA hatte ich das nicht, dort verspürte ich Leichtigkeit und konnte meine Energie auf Dinge fokussieren, die mir Freude bereiten.“
„Es ist nicht richtig, dass behinderte Menschen die Aufgabe zugeteilt bekommen, für ihr eigenes Dasein zu kämpfen. Diese Verantwortung liegt bei der Politik.“
Laura Gehlhaar
Was würdest du dir von Menschen, die das lesen, wünschen?
„Ich habe irgendwann aufgehört, mir Dinge zu wünschen, insbesondere von nichtbehinderten Menschen. Mir ist bewusst, dass diese Aussage irritieren oder verärgern kann.
Aber ich sehe es nicht mehr als meine Aufgabe an, nichtbehinderten Menschen zu erzählen, wie sie mit mir ,umzugehen‘ haben. Den Begriff ,Umgang‘ sehe ich sehr kritisch, weil er ein Machtgefälle beinhaltet. A la: ,wie gehe ich als nichtbehinderte Person mit diesen Behinderten um.‘ Das ist immer von oben herab statt auf Augenhöhe.
Wenn man dieses Thema überhaupt aufmachen möchte, sollte man von einer Begegnung sprechen. Das beinhaltet für mich ein respektvolles Miteinander.“
Auch lesen: Diskriminierung und Gewalt gegen trans* Frauen in Deutschland
Was meinst du mit „dieses Thema überhaupt aufmachen“?
„Es ist nicht richtig, dass behinderte Menschen die Aufgabe zugeteilt bekommen, für ihr eigenes Dasein zu kämpfen. Warum müssen wir uns darum bemühen, dass die Rechte behinderter Menschen endlich zu Papier gebracht und gelebt werden können?
Das ist Aufgabe jener, die entsprechende Positionen innehaben und den Stift in die Hand nehmen können, um solche Regeln aufzuschreiben. Diese Verantwortung liegt bei der Politik.“
„Viele Menschen, die sich für eine gerechte Gesellschaft engagieren, blicken mit Sorge auf die derzeitige politische Entwicklung, die sich immer mehr als Strömung entpuppt, die für viele nicht gut ausgehen wird.“
Laura Gehlhaar
Wie zuversichtlich bist du, dass Deutschland sich in Zukunft in Richtung Barrierefreiheit und Teilhabe aller am öffentlichen Leben entwickelt?
„Mit Blick auf die derzeitige politische Lage sehe ich schwarz. Nicht nur, was Barrierefreiheit und Inklusion betrifft, sondern auch darüber hinaus. Menschen, die sich für eine gerechte Gesellschaft engagieren, blicken mit Sorge auf die derzeitige politische Entwicklung, die sich immer mehr als Strömung entpuppt, die für viele nicht gut ausgehen wird.
Deshalb reagiere ich auf dieses Thema gerade sehr verhalten. Ich bin müde. Aber das sage ich bereits seit vielen Jahren. Und dessen bin ich ebenfalls müde, immer wieder zu sagen, wie müde ich davon bin.“ (lacht)
Und dennoch machst du weiter und engagierst dich.
„Ich werde mich bis zum Schluss für diese Rechte einsetzen. Anders könnte ich abends nicht mit gutem Gewissen zu Bett gehen. Hinzu kommt, dass ich diese Rechte selbst brauche.
Immerhin beobachte ich, dass das Interesse an Inklusion in den vergangenen Jahren stärker wurde. Zumindest das Wort und die Vorstellung davon, was Inklusion ist, ist mehr Menschen geläufig. Die Meinungen zu dem Thema sind eine andere Geschichte.“
Auch lesen: Platz machen für Jüngere? Erschreckende Studienergebnisse zu Altersdiskriminierung
Im Juni fanden in Berlin die Special Olympics statt und du hast einige Firmenevents dazu besucht. Wie hast du die erlebt?
„Die Special Olympics haben mich tatsächlich etwas zurückgeworfen. Bei sehr vielen Events wurde Inklusion als ,Herzensangelegenheit‘ bezeichnet, es fielen Aussagen wie ,Wir müssen die Barrieren in den Köpfen lösen‘. Da denke ich jedes Mal: ,NEIN. Das ist eben falsch.‘
Über Inklusion müssen wir sehr sachlich und konstruktiv sprechen. Inklusion ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung und keine Frage persönlichen Empfindens, sondern ein Menschenrecht. Wir brauchen Inklusion, damit behinderte Menschen Gleichberechtigung erfahren.
Solange das nicht geschieht, wird es vielen Menschen nicht gut gehen. Aktuell geht es sehr vielen Menschen sehr schlecht, weil sie Diskriminierung erfahren. Das muss sich ändern.“
„Solange Inklusion aus Freiwilligkeit heraus geschieht, sind Menschen mit Behinderung auf die Gutmütigkeit anderer angewiesen.“
Laura Gehlhaar
Du berätst Unternehmen zu Inklusion. Ist das ein Hebel, um etwas zu ändern oder geht aus deiner Sicht kaum etwas ohne die Politik?
„Ohne politische Weichenstellungen geht es nicht. Wenn man diesen Gedanken, dass es sich bei Inklusion um ein Menschenrecht handelt, tatsächlich verstanden hat, verändert sich der Blick auf diese gut gemeinten Veranstaltungen von Unternehmen.
Natürlich ist es klasse, wenn sich eine Firma für Inklusion im eigenen Betrieb einsetzt. Doch dieses Engagement auf freiwilliger Basis bringt nur bedingt etwas. Solange Inklusion aus Freiwilligkeit heraus geschieht, sind Menschen mit Behinderung auf die Gutmütigkeit anderer angewiesen.
Und solange diese Abhängigkeit besteht, wird Inklusion nicht stattfinden. Ich würde mein Geld deshalb lieber damit verdienen, Unternehmen dieses Wissen zu vermitteln, weil sie gesetzlich zu Barrierefreiheit und Inklusion verpflichtet wurden.“
Auch lesen: Alltagssexismus: Hört auf, euch über alles, was Frauen mögen, lustig zu machen
Welches Thema ist dir bezüglich der aktuellen Gesundheitspolitik besonders wichtig?
„Wir müssen dringend über den Pflegenotstand sprechen. Dazu gehört auch, dass wir darüber sprechen, wie behinderte Menschen in Deutschland alt werden. Altwerden ist für alle Menschen ein Thema, aber wir müssen uns anschauen, wie behinderte Menschen alt werden, was sie brauchen, und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit sie durch entsprechende Rechte abgesichert sind.
Wenn ich in meinem Freundeskreis die Frage stelle, wie Menschen sich das Altwerden vorstellen, lautet die erste Antwort immer: ,Ich gehe auf keinen Fall ins Heim.‘ Dieser Satz fällt nicht nur in meinem Freundeskreis, sondern auch von älteren Generationen.
Meine Eltern wohnen noch zu Hause, weil sie einigermaßen fit sind, aber auch, weil sie richtig tief sitzende Angst davor haben, ins Heim zu ziehen. Wir alle haben eine grobe Ahnung davon, wie die Zustände in deutschen Pflegeheimen sind, diese Vorstellung gruselt und frustriert die meisten.
Wenn ich diesen Gedanken weiterspinne und an die Situation in deutschen Heimen für behinderte Menschen denke, wird mir schlecht.“
„Wir müssen dringend über den Pflegenotstand sprechen.“
Laura Gehlhaar
Stimmt, viele privilegierte Menschen verschieben den Gedanken auf später, behinderte Menschen haben diese Möglichkeit oft nicht …
„Behinderte Personen sind mit diesen Zuständen bereits in jungen Jahren konfrontiert. In diesen Heimen sitzen Menschen, die dort zu den gleichen Bedingungen leben müssen wie alte Menschen und aufgrund des Pflegenotstands – brutal gesagt – ebenfalls in ihren eigenen Fäkalien im Bett liegen. Ich kenne so viele Horrorgeschichten.
Ich habe Sozialpädagogik studiert, in diesem Beruf gearbeitet und gesehen, was dort an Missbrauch stattfindet, es ist schrecklich. Niemand wünscht sich das für sein Leben. Ich kann die Aussage ,Ich gehe nicht ins Heim‘ nachvollziehen, aber ich möchte nicht so denken.
Ich möchte das Leben von allen Menschen als lebenswert erachten. Und das schließt junge und alte Menschen in Behindertenwohnheimen ein. Ihnen soll es ebenfalls gut gehen, sie sollen selbstbestimmt leben können. Deshalb brauchen wir eine Gesetzgebung, die das garantiert.“
Danke für das Gespräch, Laura.
Dieser Artikel erschien erstmal hier bei Edition F. Unsere Autorin Camille Haldner ist Teil des Teams von Edition F.